keine Kommentare
Ressourcen statt Reparatur
Woran Kinder und Eltern leiden – und warum es sich auch für die Gesellschaft lohnt, früh zu intervenieren statt später psychische Störungen zu behandeln: Ein Gespräch zum 50-Jahr-Jubiläum der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienste St.Gallen (KJPD) mit Leiterin Suzanne Erb. Am 27. August wird gefeiert.
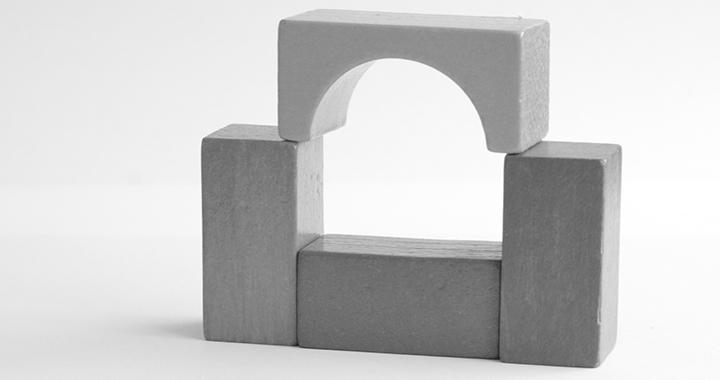
Beim Stichwort Kinder- und Jugendpsychiatrie denkt man zuerst einmal an «Problemjugendliche». Umgekehrt gefragt: Was ist für Sie das Begeisternde an Kindern und Jugendlichen?
Suzanne Erb: Begeisternd ist das Entwicklungspotential, das Neue, das mit jeder Generation entsteht. Kinder sind sowieso Hoffnungsträger, sie haben unsere Sympathien. Jugendliche sind das Innovationspotential der Gesellschaft. Und sie fordern die etablierte Gesellschaft der Erwachsenen immer neu heraus. Dafür nehmen sie viel in Kauf.
Risiken?
Risiken, ja. Und Belastungen.
Krisen in der Jugendzeit gab es seit jeher – wie haben sie sich verändert, wenn man zurückschaut auf 50 Jahre Kinder- und Jugendpsychiatrie?
Auf der einen Seite ist das Verständnis für die Herausforderungen von Jugendlichen gewachsen. Auf der anderen Seite ist der Spielraum für adoleszenztypische Themen enger geworden. Der heutigen Elterngeneration bot die von 68 geprägte Jugendkultur Frei- und Rebellionsräume. Heute dominiert die Ökonomie, junge Leute müssen sich früh auf dem Ausbildungs- und Berufsmarkt positionieren. Die Leistungsanforderungen werden sehr explizit gestellt, auch von Seiten der Eltern, und man kann ihnen das auch nicht verargen. Denn wer die Leistung nicht bringt, hat schlechtere Chancen.
Die Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienste St.Gallen sind für die Kantone St.Gallen, Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden zuständig, mit Standorten in St.Gallen, Heerbrugg, Sargans, Will, Wattwil und Unznacht. Sie feiern ihr 50-Jahr-Jubiläum mit einem Tag der offenen Tür am Samstag 27. August sowie mit einer Vortragsreihe von September bis November zum Thema «Auf hoher See – Familienbeziehungen aus verschiedenen Perspektiven».
Infos: kjpd-sg.ch
Als Heranwachsender muss man auf sehr viel Gebieten ein «Siebesiech» sein. Was sind die Folgen?
Die Zahl der Kinder, die unter dem Druck leiden, nimmt zu. Typisches Phänomen dafür ist der Schulabsentismus, den es in diesem Ausmass vor zehn Jahren noch nicht gegeben hat. Kinder wollen über Tage, manchmal Wochen nicht in die Schule gehen. Sie sagen: Das mache ich nicht mit. Das hat häufig katastrophale Folgen für den schulischen Werdegang.
Stellen die Schulen zu hohe Anforderungen?
Das kann ich so nicht sagen. Die Anforderungen kommen von allen Seiten. Und: Man hat früher Kinder vor vielen Themen eher geschützt. Man hat sie weniger involviert in elterliche Schwierigkeiten, in Entscheidungen, in unangenehme Realitäten. Das Bemühen, Kinder auf Augenhöhe anzusprechen, hat natürlich sein Gutes. Aber es bringt mit sich, dass ein Kind heute mit einer höheren Komplexität konfrontiert ist und man sich manchmal fragen muss: Entspricht das seinen kognitiven Möglichkeiten? Hinzu kommt, dass die Schere weiter aufgeht zwischen Kindern und Jugendlichen mit guten Chancen und jenen, die Belastungen und schlechten Voraussetzungen ausgesetzt sind.
Inwiefern?
Auf der einen Seite haben wir Eltern, die das Kind verstehen, ihm gerecht werden wollen und bei sich selber genau hinschauen. Daneben gibt es die Eltern, die keine Kapazität und Kraft dafür haben, die Sorgen ihrer Kinder auch zu ihren Sorgen zu machen, sondern sie allein lassen in heiklen Momenten. Solche Kinder müssen mit massiven Belastungen und Überforderungen klarkommen.
Das ist vermutlich ein Schichtproblem?
Nein, das kommt in allen Schichten vor. Nicht selten schätzen Eltern auch den Stellenwert und das Verhalten der Jugendlichen falsch ein. Sie interpretieren die altersentsprechende Abgrenzung als Ablehnung und überhören den hintergründigen Wunsch nach Zuwendung. Hier können wir «Übersetzungshilfe» leisten.
Kann die Psychiatrie nicht nur individuell, sondern auch gesellschaftlich etwas ausrichten?
Die Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienste St.Gallen sind, so lautet ihr Auftrag, für die psychiatrisch-therapeutische Versorgung Minderjähriger zuständig. Sie haben ausserdem einen Leistungsauftrag in Prävention und Weiterbildung. Wir nehmen diesen Präventionsauftrag sehr ernst. Oft kommen wir ja erst hinzu, wenn schon viel passiert ist, wenn eine Fehlentwicklung offensichtlich wird oder gar eine manifeste Störung da ist. Prävention ist deshalb wichtig – auch darum, weil die Ressourcen für Behandlung immer zu knapp sind.
Weil unsere Gesellschaft so viele Probleme macht?
Weil so viel Bedarf nach Hilfestellungen besteht. Statt «Reparatur» zu betreiben, setzen wir deshalb möglichst früh an und versuchen, entwicklungspsychologische Zusammenhänge aufzuzeigen. Wie bleibt man gesund? Wie kommen Fehlentwicklungen und psychische Erkrankungen zustande? Früherfassung nützt immens und spart immens Kosten, im Vergleich dazu, was man aufwenden muss, später Menschen mit einer psychischen Störung zu behandeln. Studien zeigen: Was man in Frühintervention bei risikobelasteten Kindern und in die Stärkung ihrer Eltern investiert, wirkt sich um circa das Sechsfache aus. Ökonomisch gesprochen, ist das ein eindrücklicher «return on invest», gerade bei Kindern mit nicht so guten Startbedingungen.
Welche sind das?
Dazu zählen etwa Kinder, die fremdplaziert sind, die oft viel durchgemacht haben. Unsere Aufgabe ist es, diese Kinder zu verstehen sowie Heime, Sonderschulen und alle Involvierten zu unterstützen. Ein grosses Thema sind Kinder psychisch belasteter Eltern. Oft fehlt das Bewusstsein, dass psychische Probleme einen erwachsenen Patienten nicht nur in der Arbeitswelt beeinträchtigen, sondern auch in seiner Elternrolle. Als Arbeitskraft bin ich ersetzbar, in meiner Elternschaft nicht. Was mit der Beziehungs- und Erziehungsfähigkeit psychisch belasteter Eltern passiert, damit hat sich die Gesellschaft noch sehr wenig befasst.
Wenn, dann kommen spektakuläre Fälle an die Öffentlichkeit, etwa Konflikte um die Rolle der Kesb, der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörden.
Ja, aber es geht um den Alltag. Viele der Kinder, die zu uns kommen, haben einen Elternteil mit psychischer Belastung. In der Behandlung arbeiten wir wenn immer möglich mit der ganzen Familie daran, gemeinsam Wege zu finden. Das kann von schulischen Massnahmen bis hin zur Einzelpsychotherapie gehen. Sehr häufig stützen wir einfach einmal die Eltern und versuchen, ihre Ressourcen zu stärken.
Ressourcen statt Reparatur?
Jeder Mensch hat Ressourcen und Belastungen, fachlich gesagt: Resilienz und Vulnerabilität. Biologische, soziale und psychische Faktoren und Ursachen spielen dabei zusammen. Als Psychotherapeutin bin ich überzeugt, dass der Mensch veränderbar und entwicklungsfähig ist. Psychotherapie ist nicht umsonst eine der effektivsten Behandlungsmethoden in der Medizin.
Das klingt nach einem optimistischen Menschenbild.
Optimistisch und zugleich kritisch. Vertrauensvoll in Bezug auf die Entwicklungsmöglichkeiten, kritisch in Bezug auf Ideen und Zuschreibungen. Denn darunter leiden viele Menschen, dass sie denken: «Ich sollte doch…» oder: «Normalerweise tut ein Kind doch…» oder: «Eine perfekte Mutter macht das und das…». Häufig sind solche Bewertungen das grösste Problem. Psychische Belastungen sind immer noch stigmatisiert.
Was sind bei Jugendlichen die hauptsächlichen Belastungen?
Der häufigste Grund für Notfälle ist Selbstmordgefährdung. Sehr oft haben wir mit Depressionen zu tun, mit Jugendlichen, die sich verschliessen, die traurig sind, deren Leistungen abfallen. Hinzu kommen Borderlinestörungen, selbstverletzendes Verhalten (nicht nur bei Mädchen), Ess- oder Schlafstörungen, schliesslich Psychosen – Störungen der Realitätswahrnehmung, die durch Drogen oder schwere Belastungen ausgelöst oder die erste Manifestation einer psychischen Erkrankung sein können. Im Jugendalter gibt es das ganze Spektrum wie bei Erwachsenen, plus spezifischere Themen wie ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Syndrom) und die damit verbundenen Schwierigkeiten in Bezug auf Selbstorganisation, Konzentration und Sozialverhalten.
Haben sich diese Symptome verschärft durch die elektronischen Medien?
Das würde ich so nicht sagen. Zumindest sind sie nicht verursachend. Sie können aber verstärkend wirken gerade bei Kindern mit Diagnose ADHS. Immer im Chatroom zu sein, das kann sehr absorbieren, zudem spielen sich dort hoch intensive Prozesse ab. Die elektronischen Medien tragen insgesamt in der Gesellschaft zu Zerstreuung bei, aber es macht keinen Sinn, sie zu verteufeln. Wir müssen damit umgehen, wie mit der Tatsache, dass es Alkohol und andere Suchtmittel gibt.
Es gibt keine spezifischen «Krankheitsbilder» der Generation der Digital Natives?
Es gibt die Internetsucht. Und wenn die Eltern den Stecker ziehen, dann kann es sein, dass solche Kinder ausflippen. Internetsucht ist jedoch, wie alle Suchtphänomene, Ausdruck einer anderen Blockade in der Entwicklung. Es geht darum, zu verstehen, wofür der Computer ein Ersatz ist. Bei Jugendlichen besteht zum Glück ein Suchtverhalten meist noch nicht so lange, dass es ein unüberwindliches Eigenleben bekommen hätte. Andrerseits können die virtuellen Welten gerade bei Jugendlichen, die ja stark mit Identitätsfindung beschäftigt sind, zusätzliche Verunsicherungen auslösen.
Jugendgewalt ist ein Thema?
Die Jugendkriminalität ist leicht zurückgegangen. Zugenommen, und dies sehr stark, hat hingegen Mobbing. Viele Jugendliche, die zu uns kommen, sind Opfer von massiven Hetzkampagnen, sehr grob, sehr entwertend, sehr primitiv. Wir arbeiten dann mit dem Schulpsychologischen Dienst zusammen, der auch in den Schulen tätig werden kann. Wir kümmern uns um das Kind selber, stützen die Eltern und arbeiten darauf hin, dass das Kind sein Selbstbewusstsein wiederfindet. Denn für Jugendliche gibt es nichts Wichtigeres als dazuzugehören – entsprechend schlimm ist Mobbing.
Wissen die Jungen nicht, was sie tun?
Die Auswirkungen von Mobbing sind jedenfalls viel schlimmer, als sich die meisten das vorstellen können. Und die Chatrooms haben das Problem verstärkt. Wenn jemand öffentlich, für alle lesbar erniedrigt wird, hat das eine viel massivere Wirkung als früher, wo man sich eher entziehen konnte.
Sie haben auch Borderline-Störungen angesprochen.
Emotionale Berg- und Talfahrten gehören zum Jugendalter dazu. Aber es gibt Jugendliche, die besonders stark reagieren – eine Ursache kann sein, dass sie in der frühen Kindheit seelischen Verletzungen ausgesetzt waren. Borderline-Störungen sind gekennzeichnet durch Instabilität der Gefühle, die Schwierigkeit, Beziehungen befriedigend zu erleben, Nähe und Distanz gut zu steuern. Oft ist eine starke Suche nach Nähe zugleich mit riesiger Angst davor verbunden. Eine Folge kann selbstverletzendes Verhalten sein. Wir bieten neben Einzeltherapien neu eine Skillsgruppe an, eine Art Training, in dem Jugendliche den Umgang mit ihrer Gefühlswelt erproben können.
Wie kommen die Jugendlichen überhaupt zu Ihnen?
Die meisten werden von ihren Eltern angemeldet, oft auf Anstoss von Fachleuten. Auch Behörden können uns ein Kind anmelden. Andere werden vom Arzt überwiesen. Und Jugendliche können sich selber melden oder kommen direkt vorbei. Wir respektieren ihr Recht, allein zu kommen, aber wir versuchen wenn immer möglich die Eltern einzubeziehen. Die Eltern sind die nächsten Bezugspersonen, sie sind meistens ebenfalls in grosser Sorge, und sie haben die Verantwortung.
Eltern haben grosse Macht.
Wenn sie verhindern, dass ein Kind zu uns kommt, dann erfahren wir es nicht. Aber wenn unterschiedliche Auffassungen darüber bestehen, ob ein Kind ein Problem hat oder was das Problem ist, dann setzt man sich damit auseinander, und dieser Prozess führt oft zu einer Verbesserung der Beziehung und zum Kern des Problems. Entscheidend ist: Wir suchen nicht Schuldige, sondern wir wollen Hilfestellung geben. Wir gehen davon aus, dass Eltern das Beste für ihr Kind wollen. Es ist für sie teilweise ausserordentlich schwierig, zu uns zu kommen, weil sie sich selber grosse Vorwürfe machen oder sich schämen. Unnötigerweise, denn perfekt ist niemand, und Schwierigkeiten haben immer mehrere Ursachen. Wichtig ist, dass man etwas ändern will. Oft sagen Eltern am Schluss einer Behandlung: Wir stehen heute an einem ganz anderen Punkt. Wenn mein Kind nicht mit einer Störung reagiert hätte, wäre die Veränderung nicht passiert.
Jugendliche sind offensichtlich gute Katalysatoren?
Alle Kinder wollen, dass es ihrer Familie, den Eltern und den Geschwistern gut geht. Auch wenn Jugendliche mal lautstark sagen: Meine Eltern verstehen das nicht, es interessiert sie nicht, oder: Meine Eltern dürfen damit nicht belastet werden. Unsere Antwort ist: Wenn Eltern ein Teil des Problems sind, dann sollen sie auch ein Teil der Lösung werden.
Das Bewusstsein dafür war vermutlich nicht immer so ausgeprägt?
In den Anfängen der Kinder- und Jugendpsychiatrie ging es darum, überhaupt Verständnis dafür zu wecken, dass Kinder ein Seelenleben haben. Und es ging um die Probleme und Folgeprobleme der Armut. Das ist heute immer noch aktuell, es hat sich leider nur graduell, aber nicht fundamental geändert. Heute steht für uns im Vordergrund, effektive Angebote zu entwickeln, die noch mehr Breitenwirkung entfalten. Was sich geändert hat: Man ist besser informiert und damit zu Recht anspruchsvoller geworden. Es gibt ein Bedürfnis nach Spezial-Sprechstunden. Wir haben eine Baby-Sprechstunde aufgebaut, eine Autismus-Sprechstunde, eine Ess-Sprechstunde, wir werden eine Trauma-Sprechstunde einrichten. Sprechstunde heisst bei uns: Wir bilden Teams, die dafür sorgen, dass das Spezialwissen in allen sieben Standorten in unserem grossen Kantonsgebiet vorhanden ist.
Zum Schluss: Was sind Ihre Erwartungen an die Politik?
Ich erzähle dazu eine kleine Geschichte. Ein junger Mann kommt an die Theke eines Ladens und fragt: Was verkaufen Sie? Der Ladenbesitzer, ein älterer Herr antwortet: Alles, was Sie wollen. Entgegnet der Junge: In diesem Fall hätte ich gern den Weltfrieden, das Ende des Hungers und Glück für alle Menschen. Sie müssen entschuldigen, junger Mann, entgegnet der Alte: Wir verkaufen keine Früchte, wir verkaufen nur den Samen. So ist es mit der Kinderpsychiatrie. Wenn man «Glück» mit psychischer Gesundheit gleichsetzen will, heisst das: Wir können Gesundheit nicht verkaufen. Aber wir können dazu beitragen und glauben daran, dass die meisten Menschen die Ressourcen haben, mit Unterstützung ein gesundes Leben zu entwickeln. Mein Wunsch ist, dass wir uns besser hörbar machen können und auch gehört werden. Die Kenntnis über entwicklungspsychologische Zusammenhänge müsste auch in der Politik selbstverständlicher werden. Das Wissen ist vorhanden, es kommt aber abhanden, sobald es etwas kostet.
Dieser Beitrag erschien im Juli-August-Heft von Saiten. Bilder: Miriam Lambek/KJPD






