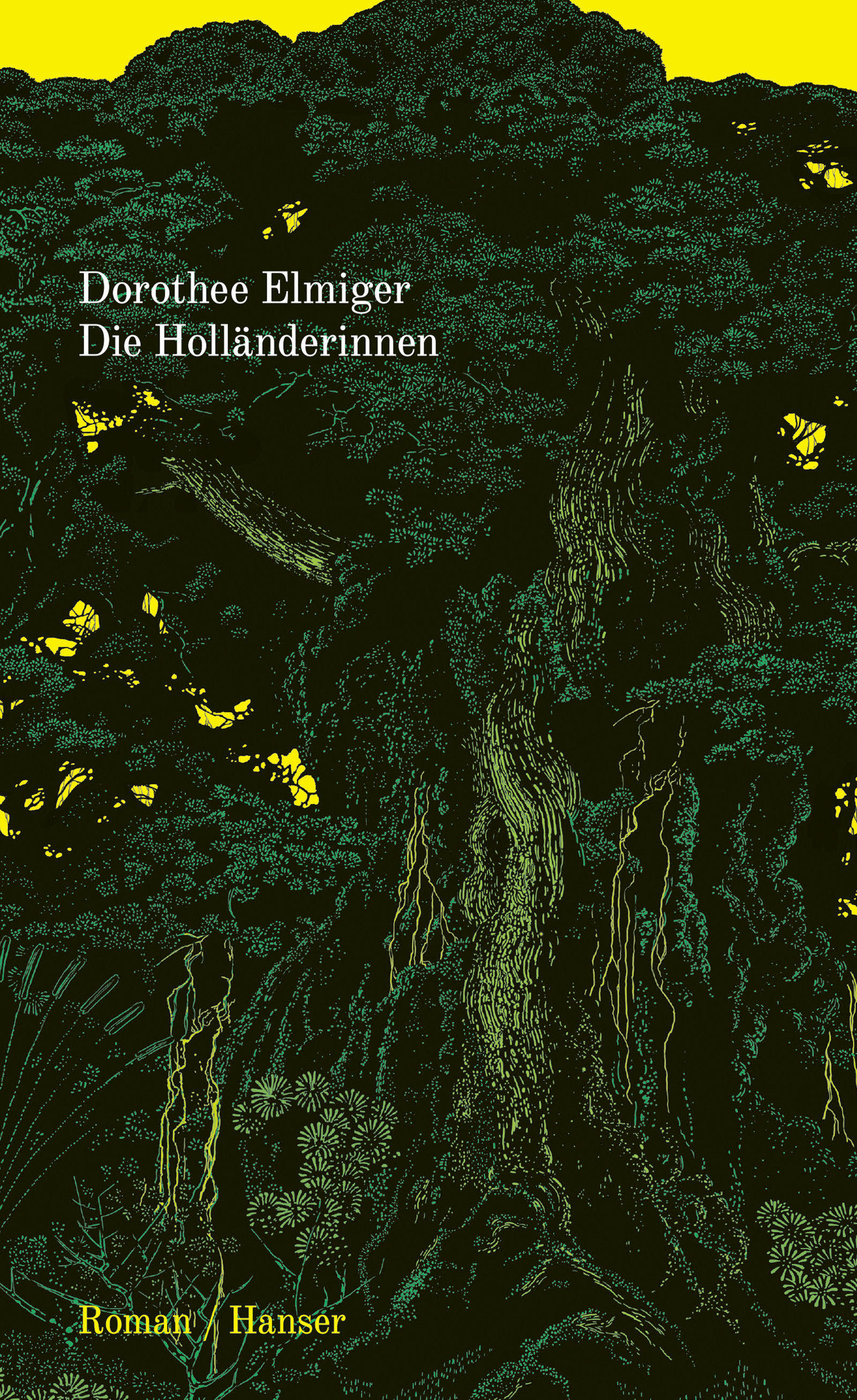Irgendwann im letzten Drittel des Romans ahnt die Erzählerin, «dass es hier keine Pointe geben, dass die Geschichte auf keine Auflösung, kein Ende zulaufen würde». So kommt es denn auch, und wir sind nicht überrascht, die Anzeichen waren schon früh da, die Befürchtung, «man verliere sich im Lauf dieser lichtlosen Leere, in der sich alles auf ein nur noch dunkles Zentrum zubewege». Und die Autorin wäre nicht Dorothee Elmiger, wenn sie es sich und uns mit einer irgendwie gearteten Auflösung einfach machen würde. Nicht einmal in einem «Krimi», wie es einmal im Buch heisst.
Tatsächlich sind die Holländerinnen, die dem vierten Roman der aus Innerrhoden stammenden, seit einiger Zeit in den USA lebenden Autorin den Titel geben, ein cold case: Vor zehn Jahren sind die zwei jungen Frauen im südamerikanischen Dschungel verschollen. Ein bekannter Theatermacher, Verfechter eines, wie es die Autorin nennt, «hypnotischen Realismus» à la Milo Rau, will dem Fall vor Ort nachgehen und lädt die Erzählerin ein, als eine Art Protokollantin an der Expedition teilzunehmen.
Sie sagt zu, reist mit Flugzeug, Bus und Boot an den menschen- und gottverlassenen Treffpunkt im Dschungel, zusammen mit einer Handvoll anderer Teilnehmer:innen. Und stellt rasch fest, dass die Dinge sich hier, im «Herz der Finsternis», nicht zusammenfügen, sondern immer mehr aus dem Ruder laufen.
Wuchernde Bedrohung
In so grandiosen wie verstörenden Bildern fängt der Roman die Atmosphäre der wachsenden Bedrohung ein. In Fetzen tauchen Dokumente aus den letzten Tagen der Holländerinnen auf, rätselhaft nachtdunkle Fotos, «kritische Nachtbilder» genannt, oder eine abbrechende Tonaufnahme. Sie überlagern sich mit den Erlebnissen der Theatergruppe. Unfälle passieren, die Notizen der Erzählerin wischt der tropische Regen weg, unheimliche Geräusche verschrecken Autorin und Leser. In einer beklemmenden Apotheose macht sich die Gruppe schliesslich auf die Spur der Verschollenen im zunehmend weglosen Dschungel.
Elmiger bleibt zwar an der Chronologie der Ereignisse dran, bricht sie aber auf mit ständig neuen Erzählungen und Erzählanläufen. Auf den tropisch verschlungenen Wegen oder beim Nachtlager notiert die Erzählerin, was andere ihr berichten, Angst- und Schuldgeschichten, Anekdoten aus dritter Hand oder Bruchstücke aus Büchern, in deren unablässig labyrinthischen Verschlaufungen sich die Erfahrung verdichtet, dass sich die Welt nur noch in Splittern und «blitzhaften» Szenen, wenn überhaupt, fassen lässt.
Unter den Episoden, die allesamt die schlechtestmögliche Wendung nehmen, ist die «Ziegengeschichte» besonders verstörend. Eine Mitreisende, die «Schweizerin» genannt, erzählt: Sie habe es vor einiger Zeit übernommen, auf einem Hof im Rheintal die Ziegenherde eines Bekannten für ein paar Wochen zu hüten. Was sich locker anlässt, wird zur Apokalypse, als eine Ziege nach der anderen ein totes oder nicht lebensfähiges Kitz gebärt. Die junge Frau gerät in ein «höllisches Spektakel», das unerklärt bleibt. Aber lesbar ist als Sinnbild einer Natur, die in diesem Roman auf allen Ebenen aus dem Lot geraten ist.
«Fast ausserirdisch»
In der Rahmenhandlung hält die Erzählerin ein Seminar an einer amerikanischen Uni, wo sie über ihr Schreiben und ihre Poetologie berichten soll. Stattdessen erklärt sie einleitend, wie sich ihr «eigentliches» Schreiben aufgelöst habe, ihr ganzes Schaffen im Dschungel einen Prozess der Fragmentierung durchgemacht habe, der es ihr unmöglich mache, eine Theorie ihres Schaffens vorzulegen, sondern höchstens eine Theorie der Auflösung, des Abbrechens, des Auseinanderfallens, im Grunde allerdings letztlich überhaupt keine Theorie.
Als konsequente Folge dieser Erzählerinnen-Prespektive ist der ganze Roman in indirekter Rede verfasst. Das erzeugt beim Lesen paradoxerweise sowohl eine Distanzierung als auch einen narrativen Sog, als zöge einen der erzählte Dschungel mit jeder Seite mehr in seine Lianen-Umarmungen und seine sintflutartigen Wolkenbrüche herein. Und lasse nicht mehr los.
Elmigers vierter Roman ist ein kluges, labyrinthisches, vertracktes Leseabenteuer. Dass man mit ihm an kein Ende kommt, verbindet uns Lesenden mit dem Schicksal der Teilnehmer:innen der Expedition – «je länger sie gegangen seien, desto mehr hätten sie sehen können, desto mehr hätten sie begriffen, und doch sei ihnen alles noch immer unleserlich, fast ausserirdisch vorgekommen.»
Das klingt wie ein spätes Echo auf Hofmannsthals Brief des Lord Chandos, dem Dokument einer Sprach- und Gesellschaftskrise an der vorletzten Jahrhundertwende: Ihm faulten die Worte im Mund wie modrige Pilze, «alles zerfiel in Teile, die Teile wieder in Teile, und nichts mehr liess sich mit einem Begriff umspannen».
Keine Auflösung, kein sicherer Begriff in Sicht – das sei, wie die Erzählerin in ihrer Vorlesung festhält, «im Licht der gegenwärtigen Verhältnisse» auch einleuchtend, «Verhältnisse, die fraglos und im vielfachen Sinn schlecht, ja tödlich seien». Elmigers Erzähl-Dschungel ist das Porträt einer ausweglosen Gegenwart.
Dorothee Elmiger: Die Holländerinnen, Hanser Verlag 2025
Buchvernissage: 1. Oktober, Literaturhaus St.Gallen